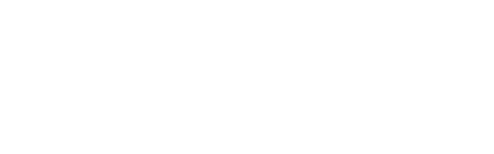Das Gesetzespaket, das US-Präsident Donald Trump Ende Anfang Juli trotz des Widerstands selbst unter den Republikanern durchgedrückt hat, birgt für die amerikanische Wirtschaftspolitik kaum abschätzbare Risiken, mahnt Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE, in seinem aktuellen Kommentar. Unter anderem hat Trump Steuererleichterungen aus seiner ersten Amtszeit im Volumen von 4,5 Billionen US-Dollar verlängern lassen. Mit diesem Gesetz hebelt Trump die Haushaltsdisziplin aus und macht den Weg für eine Ausweitung des ohnehin schon hohen Haushaltsdefizits und eine weitere Erhöhung der Staatsverschuldung frei. Notwendige Investitionen in die amerikanische Infrastruktur werden mit kurzfristigen Steuergeschenken oder Subventionen verknüpft. Dies hat zur Folge, dass Haushaltsmittel ineffizient verteilt werden, was langfristiges Wachstum eher behindert. Die amerikanischen Staatsfinanzen gründen künftig allein auf dem Prinzip Hoffnung.
Die Wette, die Trump und Bessent eingehen, ist riskant. Doch sie muss nicht zwangsläufig schiefgehen. Die amerikanischen Aktienmärkte haben zunächst positiv auf das Gesetz reagiert. Nur halten wir die Gefahren, die diese Haushaltspolitik den amerikanischen Bürgern aufbürdet, für unangemessen hoch. Die Staatsfinanzen sind zu wichtig, um mit ihnen Vabanque zu spielen.
Bei etwa 123 Prozent des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegt aktuell die amerikanische Staatsverschuldung oder 36,2 Billionen US-Dollar. Im laufenden Fiskaljahr könnten zwei von sieben Billionen US-Dollar (fast 30 Prozent) schuldenfinanziert werden. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt betrug das Haushaltsdefizit gut 6 Prozent. Das ist das Doppelte dessen, was innerhalb der Eurozone als tragfähig gilt. Durch den OBBBA wird sich die Unterfinanzierung des Staatshaushalts rasant ausweiten. Höhere Zinskosten und die langfristige Beibehaltung einiger Steuererleichterungen würden das Defizit nach Schätzungen des Committee for a Responsible Federal Budget über zehn Jahre um 5,5 Billionen US-Dollar höher ausfallen lassen.
Die Schuldenfinanzierung von Trumps wirtschaftspolitischen Zielen könnte eine völlig neue Lage an den globalen Anleihemärkten schaffen. Mit dieser enormen Ausweitung der Staatsschulden macht sich Trump abhängiger vom Wohlwollen der Finanzmärkte als jeder andere US-Präsident vor ihm. Sollten die Anleger das Vertrauen in die amerikanische Finanzpolitik verlieren, könnte es schwierig werden, die enormen Schulden zu finanzieren beziehungsweise zu refinanzieren.
Die Anleiherenditen würden steigen, der Dollarkurs fallen. Aus einer Schuldenkrise würde in diesem Fall eine Finanzkrise werden. Der Status des Dollar als Weltleitwährung hat es bisher jeder amerikanischen Regierung nach 1945 erleichtert, den Staatshaushalt über internationales Finanzkapital zu finanzieren. Das muss allerdings nicht so bleiben, zumal die wichtigen ausländische Investoren in den vergangenen Monaten vermutlich einiges skeptischer gegenüber Anlagen in den USA geworden sind.
Noch ist der Renditeanstieg amerikanischer Staatsanleihen nicht dramatisch. Doch der Schuldendienst der US-Regierung hat sich in den vergangenen drei Jahren schon empfindlich verteuert. Anfang Juli 2022 waren zehnjährige Treasuries mit rund 3 Prozent verzinst. Aktuell liegt die Rendite bei knapp 4,4 Prozent. Dreißigjährige Anleihen wurden zeitweise bei mehr als 5 Prozent gehandelt. Beim Dollar ist das Misstrauen internationaler Anleger klarer zu sehen: Von rund 1,03 Dollar je Euro bei Trumps Amtsantritt am 20. Januar ist der Wechselkurs auf aktuell rund 1,17 Dollar gefallen.
Doch es ist nicht die Haushaltspolitik allein. In diesem Fall ist es die Mischung, die das Gift macht: Die Finanzpolitik ist zu expansiv. Die Geldpolitik ist zu restriktiv. Die Handelspolitik ist zu erratisch.
Mit dem Leitzins im Band von 4,25 bis 4,5 Prozent liegt die amerikanische Notenbank Fed weit über der aktuellen Inflationsrate. Selbst die Kerninflation, die sich in der Regel hartnäckiger hält als die allgemeine Inflationsrate und deshalb schwerer zu bekämpfen ist, betrug im Mai 2,8 Prozent, die allgemeine Inflationsrate 2,4 Prozent. Somit sind die realen Zinsen, also die nominalen abzüglich der Inflationsrate, in den USA mit knapp 2 Prozent weiterhin recht hoch. Über die letzten Monate ist der Realzins sogar gestiegen.
Doch die Fed sträubt sich aus unserer Sicht zu Recht, mit weiteren Zinssenkungen voranzugehen. Trumps launenhafte Zollpolitik und seine riskante Schuldenpolitik erhöhen die Unsicherheit und erschweren eine solide Geldpolitik. Damit belasten die Zinsen die US-Wirtschaft vielleicht mehr als unter anderen Umständen notwendig wäre. Dies trifft Unternehmen und Privathaushalte sowie den Immobiliensektor. Zudem könnten die wirtschaftlichen Risiken die Banken veranlassen, bei der Vergabe von Darlehen etwas vorsichtiger zu sein.
Wir gehen davon aus, dass die erratische Handelspolitik und die massive Inanspruchnahme des Kapitalmarkts durch den Staat dazu beitragen werden, dass die Zinsstrukturkurve in den USA steiler wird. Während die langfristigen Zinsen in den USA und der Wert des US-Dollars in der Vergangenheit positiv korreliert waren, kam es seit der am „Liberation Day“ verkündigten Zollpolitik zu einer deutlichen Entkopplung der beiden Größen – wie die voranstehende Graphik zeigt. Seither fällt der US-Dollar-Index, während die Renditen von US-Staatsanleihen zunächst stiegen und sich nun auf erhöhtem Niveau halten. Die Kombination aus loser Fiskalpolitik, erratischer Handelspolitik und gleichzeitig restriktiver Geldpolitik in den USA hat zu einem Vertrauensverlust der Anleger geführt.