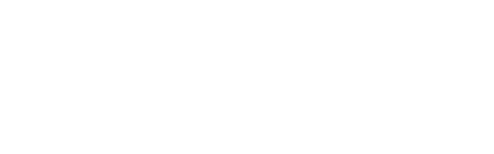Ein großer Wurf ist es nicht. Vor gut einem Jahr beendete der Bruch der Ampel-Koalition das Gesetzgebungsverfahren zum sogenannten zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz, kurz BRSG 2. Nachdem Verbände erneut Stellung beziehen konnten, hat jetzt das Bundeskabinett der „kleinen Groko“ den Regierungsentwurf beschlossen. Die Änderungen gegenüber dem „Vorgänger“ halten sich in Grenzen. Aber erstmal abwarten, denn der Entwurf wird jetzt wie üblich in Bundestag und Bundesrat diskutiert und beraten. Wenn es nach dem Willen der Regierung ginge, würde das Gesetz am 1. Januar 2026 in Kraft treten.
Erklärtes Ziel ist die stärkere Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV), was vor allem auf drei Feldern erreicht werden soll. Erstens, eine stärkere Förderung des Sozialpartnermodells. Nach erheblichen Startschwierigkeiten gibt es inzwischen über zehn dieser Einrichtungen. Arbeitgebern gefallen an den Modellen die reduzierten Haftungsrisiken und geringeren Verwaltungskosten, Arbeitnehmern die flexiblere Kapitalanlage mit höheren Renditechancen, da keine starren Garantien vorgegeben sind. Künftig sollen sich nicht tarifgebundene Unternehmen bereits bestehenden Sozialpartnermodellen anschließen können, wenn deren Arbeitnehmer in den Zuständigkeitsbereich der Gewerkschaft fallen, die das Sozialpartnermodell mitträgt, und wenn das Sozialpartnermodell sich entsprechend öffnet. Das soll besonders kleineren Unternehmen ermöglichen, ihren Beschäftigten eine Betriebsrente anzubieten, ohne dass ein eigener Tarifvertrag abgeschlossen werden muss.
Mehr Durchschlagskraft erwünscht
Positiv, aber nicht kritiklos, sind auch die Vorhaben bei sogenannten Opting-Out-Regelungen und der Geringverdienerförderung zu bewerten. Bei Letztgenannter soll der maximale Förderbetrag erhöht werden und korrespondierend dazu der Lohnsteuerfreibetrag. Vorgesehen ist auch eine Dynamisierung der Gehaltsgrenzen, bis zu denen diese geförderte bAV durchgeführt werden kann. Dies soll Impulse für die stärkere Verbreitung der bAV geben, die laut Experten in diesem Bereich tendenziell am geringsten ist. Allerdings sieht der Entwurf vor, dass die Regelung – zu vermuten sind finanzielle Gründe – erst zum 1. Januar 2027 in Kraft treten wird.
Durch die Einführung von Opting-Out-Regelungen nehmen Arbeitnehmer automatisch an einer betrieblichen Entgeltumwandlung teil, vorausgesetzt sie widersprechen nicht aktiv. Experten bemängeln aber, dass diese Möglichkeiten mit Blick auf die betriebliche Praxis nur für einen sehr eingeschränkten Anwendungsbereich geschaffen werden und damit verpuffen würden. Das verwundert insofern nicht, da auf die Einführung eines solchen Obligatoriums als Handlungsoption im Rahmen der Evaluierung der Maßnahmen in dem jetzigen Entwurf verzichtet wurde. Jetzt soll geprüft werden, ob die geplante Öffnung der Sozialpartnermodelle wirklich zu einer Verbreitung der bAV geführt hat, dies allerdings nicht schon nach drei, sondern erst nach fünf Jahren.
Ein großer Wurf sollte es wohl nicht werden. Denn eine Rentenkommission soll erst 2026 Vorschläge für eine große Reform machen, welche auch die gesetzliche und private Altersvorsorge umfasst. Gleichwohl wäre es zielführend, schon jetzt mit mehr Durchschlagskraft zu agieren. Das gilt im Übrigen auch für die wenig hilfreichen Garantievorgaben jenseits des Sozialpartnermodells, die einmal mehr unangetastet bleiben.