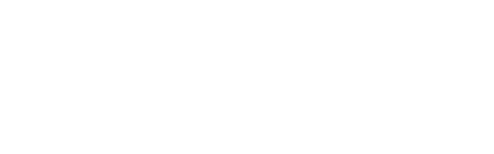Im Rahmen des sehr breitflächigen (und kaum empirisch nachgewiesenen) Arguments der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die EU ein (weiteres) umfassendes Paket an rechtlichen Maßnahmen auf den Weg gebracht. Teil dieses Pakets ist auch die Einrichtung einer eigenen zentralen neuen EU-Behörde, der Anti Money Laundering Authority (AMLA) mit Sitz in Frankfurt. Die Verordnung, mit der diese neue Behörde geschaffen wurde, gilt ab 1. Juli 2025 (Verordnung (EU) 2024/1620).
Teil dieses Maßnahmenpakets sind auch eine Verordnung zur Einführung eines einheitlichen Regelwerks für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-VO), eine Richtlinie mit weiteren umfassenden neuen Regelungen, die diese Verordnung ergänzt und jeweils in nationales Recht umzusetzen ist (6. Geldwäscherichtlinie), eine Neufassung der Geldtransfer-Verordnung und weitere Begleitmaßnahmen.
Die Einrichtung der AMLA soll insbesondere dem Umgang mit Vorfällen grenzüberschreitender Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung dienen. Insbesondere geht es hier auch um eine effiziente Nutzung von Daten, wobei für die Datengewinnung in der Praxis auf durchaus umstrittene technische und rechtliche Mittel gesetzt wird.
Die neue Behörde wird sowohl – in eingeschränktem Maße – direkte als auch indirekte Aufsichtsbefugnisse haben. Es handelt sich dabei um ein Zusammenspiel aus der AMLA, den nationalen Geldwäscheaufsichtsbehörden und den nationalen FIU (Financial Intelligence Units), also den nationalen Behörden, bei denen entsprechende Verdachtsmeldungen einzubringen sind.
Kredit- oder Finanzinstitute oder entsprechende Gruppen, deren Restrisikoprofil als hoch eingestuft wird, werden direkt von der AMLA beaufsichtigt. Zielgröße sind 40 Institute. Dies hängt somit nicht zwingend mit der Größe der Institute zusammen, sie müssen allerdings eine entsprechende grenzüberschreitende Tätigkeit aufweisen. Die erste Auswahl dieser direkt beaufsichtigen Institute erfolgt bis zum 1. Juli 2027. Daneben kann es auch bei außergewöhnlichen Umständen auf Ersuchen einer Aufsichtsbehörde zu weiteren direkten Zuweisungen an die AMLA kommen.
Die AMLA soll sowohl für die (teils direkte, teils indirekte) Aufsicht über Bank- und Finanzinstitute im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig sein wie auch für Kryptoanbieter. Weiters soll sie auch für Finanzsanktionen und deren Einhaltung (als nunmehrige Geldwäsche-Vortat) Zuständigkeiten haben, was insbesondere vor dem Hintergrund der umfassenden Sanktionen gegen Russland aktuell relevant ist. Hierbei geht es insbesondere um die Analyse bei der mangelnden Umsetzung oder Umgehung finanzieller Sanktionen und die Einhaltung von Sanktionen durch ausgewählte Verpflichtete sowie eine einheitliche Aufsichtspraxis in diesem Bereich.
Zu den Aufgaben der Behörde gehört die Bewertung von Bedrohungen, Auffälligkeiten und Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wobei sich dies auch auf Drittländer bezieht, soweit die EU betroffen ist. Sie hat auch Informationen zu sammeln und zu analysieren und Schwachstellen bei den Aufsichtsbehörden aufzugreifen.
Zu den umstrittenen Befugnissen gehört die Einrichtung einer zentralen Datenbank.
Dabei hat sich die AMLA auch um Informationsaustausch zwischen den betreffenden nationalen Behörden zu kümmern und diesen erforderliche Informationen aus der zentralen Datenbank auf Basis des „need-to-know“-Prinzips zur Verfügung zu stellen. Sie berichtet auch an die EU-Kommission über mangelnde Umsetzungen und hat weitere Aufgaben wahrzunehmen.
Neben der Überwachung des Finanzsektors und der Aufsichtsbehörden hat die AMLA auch Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht des Nichtfinanzsektors, wie etwa die Führung eines Verzeichnisses der dortigen Aufseher, die koordinierte Analyse der Aufsichtsstandards, die Untersuchung potenzieller Verstöße und sonstige Unterstützung. Damit greifen die Befugnisse der Behörde sehr weit in den grundsätzlich nicht von der Finanzaufsicht beaufsichtigten Bereich hinein.
Die Befugnisse der Behörde sind äußerst weitreichend; auch einzelne Konten oder Transaktionen können eventuell gesperrt werden. Im Hinblick auf die direkt Beaufsichtigten hat sie auch die Möglichkeit, Geldbußen und Zwangsgelder zu verhängen, ferner kann sie nationale Behörden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben auffordern.
Die Höhe der Geldbußen variiert je nach Schwere der Verstöße und beträgt im äußersten Fall zehn Millionen Euro oder sogar zehn Prozent des Jahresumsatzes (nicht bloß des Gewinns). Daneben können zur Durchsetzung auch Zwangsgelder verhängt werden. Geldbußen gegen nicht direkt von der AMLA Beaufsichtigte werden von den nationalen Aufsichtsbehörden verhängt, wobei in vielen Fällen ein Austausch dazu mit der AMLA bestehen wird.
Die AMLA kann auch weitere Daten anfordern sowie Leitlinien und Empfehlungen herausgeben.
Die AMLA kann auch Vor-Ort-Untersuchungen bei ausgewählten Verpflichteten vornehmen.
Im Nichtfinanzsektor (worunter auch Selbstverwaltungskörper wie Kammern fallen) kann die Behörde Informationen verlangen, mögliche Verstöße untersuchen, bei Maßnahmen koordinieren und unterstützen sowie vergleichende Analysen der Tätigkeiten von Aufsehern durchführen. Dabei kann sie auch die Berichte von internationalen Organisationen und zwischenstaatlichen Stellen berücksichtigen und kann Public-Private Partnerships mit entsprechendem Informationsaustausch eingehen (z. B. NGOs). Weiters kann sie auf die zentrale Datenbank zugreifen. Sie unterstützt im Rahmen ihrer Befugnisse und unbeschadet der Befugnisse der Aufseher des Nichtfinanzsektors deren Aktivitäten im Bereich der Geldwäscheprävention. Weiters kann sie auch die zentralen Meldestellen (FIU) der einzelnen Staaten koordinieren und gemeinsame Analysen durchführen.
Die Behörde ist auch für technische Regulierungs- und Durchführungsstandards zuständig, wobei derzeit rund 70 in Ausarbeitung sind. Weiters verfügt sie über einen Meldekanal für Hinweisgeber (Whistleblower).
Die Behörde und ihre Befugnisse sind in einem größeren Kontext einzuordnen:
• Weitgehendes Verbot von Bargeldtransaktionen in der EU über EUR 10.000 ab 10. Juli 2027
• Mögliche Einführung eines Vermögensregisters für Werte über EUR 200.000
• EU-weite Verknüpfung der Daten aus den Registern über wirtschaftlich Berechtigte (Eigentümer, wobei die Schwelle hier auf 25 Prozent gesenkt wurde), Konten- und Immobilienregister zu einem (jederzeit erweiterbaren) EU-Vermögensregister sowie Registerdaten über Geld- und Kryptotransfers, Reisedaten, Sozialversicherungsdaten, KfZ-Register, Schließfächer, Zolldaten u. a. mit vollem Zugriff der AMLA
• Zugang zu Daten über wirtschaftlich Berechtigte auch für gewisse Journalisten, NGO und Wissenschaftler
• Regulierung von Kryptotransaktionen
• Schaffung eines elektronischen Euro (central bank digital currency – CBDC)
• Weiters: Verknüpfung der Identität mit Bankkonto bei Transferempfängern auf weltweiter Basis aufgrund neuer Vorhaben der UNO (Global Digital Compact)
Nach der 6. EU-Geldwäscherichtlinie kommt es somit insbesondere auch zur Verknüpfung von Informationen in einem sehr umfangreichen Bereich. Die Informationen über Beteiligungen werden auch umfassen, ob die angegebenen wirtschaftlichen Eigentümer gezielten Finanzsanktionen unterliegen.
Weiters soll die Durchführung von Inspektionen in den Betriebsstätten der betroffenen juristischen Person ermöglicht werden, um die Aktualität oder generelle Richtigkeit der Angaben von wirtschaftlichen Eigentümern zu überprüfen. Gerade in diesem Bereich sind immer wieder grundrechtlich problematische Vorgänge zu beobachten, wie bereits aus einigen EU-Mitgliedstaaten aufgrund nationaler Regelungen berichtet wird.
Mit den umfangreichen Befugnissen der AMLA und der nationalen Behörden sind – abseits eines gerichtlichen Verfahrens mit den dortigen Verfahrensgarantien – erhebliche Eingriffe ins Privat- und Geschäftsleben der Bürger möglich, die bis zur Existenzvernichtung gehen können. Die Ausrichtung auf einen risikobasierten Ansatz verhindert nicht Missbrauch und überschießende Maßnahmen; eine Beschränkung auf schwerste Kriminalität fehlt. Auch die massiven Befugnisse außerhalb des Finanzsektors (etwa bei selbstverwalteten Kammern) sind verfassungsrechtlich höchst problematisch.
Darüber hinaus gibt es erhebliche Konflikte mit dem Datenschutz, der Privatsphäre, dem Recht auf Eigentum und Erwerbsfreiheit und dem rechtsstaatlichen und liberalen Grundrechtsprinzip, sodass die Einführung solcher Maßnahmen in einigen Mitgliedstaaten (z. B. Österreich) wohl eines zwingenden Referendums (Volksabstimmung) bedarf. In Verbindung mit einer obrigkeitsstaatlichen Beschränkung des einzig anerkannten gesetzlichen Zahlungsmittels – Bargeld –, der Einführung einer programmierbaren digitalen Währung und stets erweiterten Compliance-Anforderungen, die in der Praxis schon teilweise zu einer de facto (rechtswidrigen) Beweislastumkehr und volkswirtschaftlichen Nachteilen führen, wird hier mit umfassenden Befugnissen und Datensammlung offensichtlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Einem einzigen Ziel (dessen Erreichung auch auf Basis dieser Maßnahmen zudem fraglich ist) werden grundlegende Rechte, Freiheiten und wirtschaftliche Möglichkeiten untergeordnet und potenziell die gesamte Bevölkerung und finanzielle Aktivitäten strukturell unter Generalverdacht gestellt. Die Bekämpfung echter Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist – vor allem im Bereich der Gewaltkriminalität sowie des Menschen- und Drogenhandels – ein sehr wichtiges Anliegen; die Erfahrung zeigt jedoch, dass diese Maßnahmen neben absolut berechtigten Fällen oftmals nicht die eigentliche Zielsetzung erreichen und dafür breitenwirksam über das Ziel schießen und die Gefahr rechtlicher und wirtschaftlicher Repression begründen, wobei die Betroffenen oft nicht in den Genuss gerichtlicher Verfahrensgarantien kommen.
Gerade auch rechtlich fragwürdige Maßnahmen wie Bargeldbeschränkungen und umfassende Datensammlung dürften nicht vorwiegend dazu dienen, echte Schwerverbrechen in den genannten Bereichen zu verhindern, zumal Verbrecher in diesen Bereichen mit ganz anderen Methoden arbeiten. Auch Willkür und überschießende Anforderungen in der Praxis sowie wirtschaftliche Nachteile im Vergleich zu anderen Rechtsräumen sind jetzt schon laufend zu beobachten. Eine breite (auch grundrechtliche) Diskussion und Hinterfragung dieser Maßnahmen sind daher dringend erforderlich. Die kritischen Stimmen mehren sich.